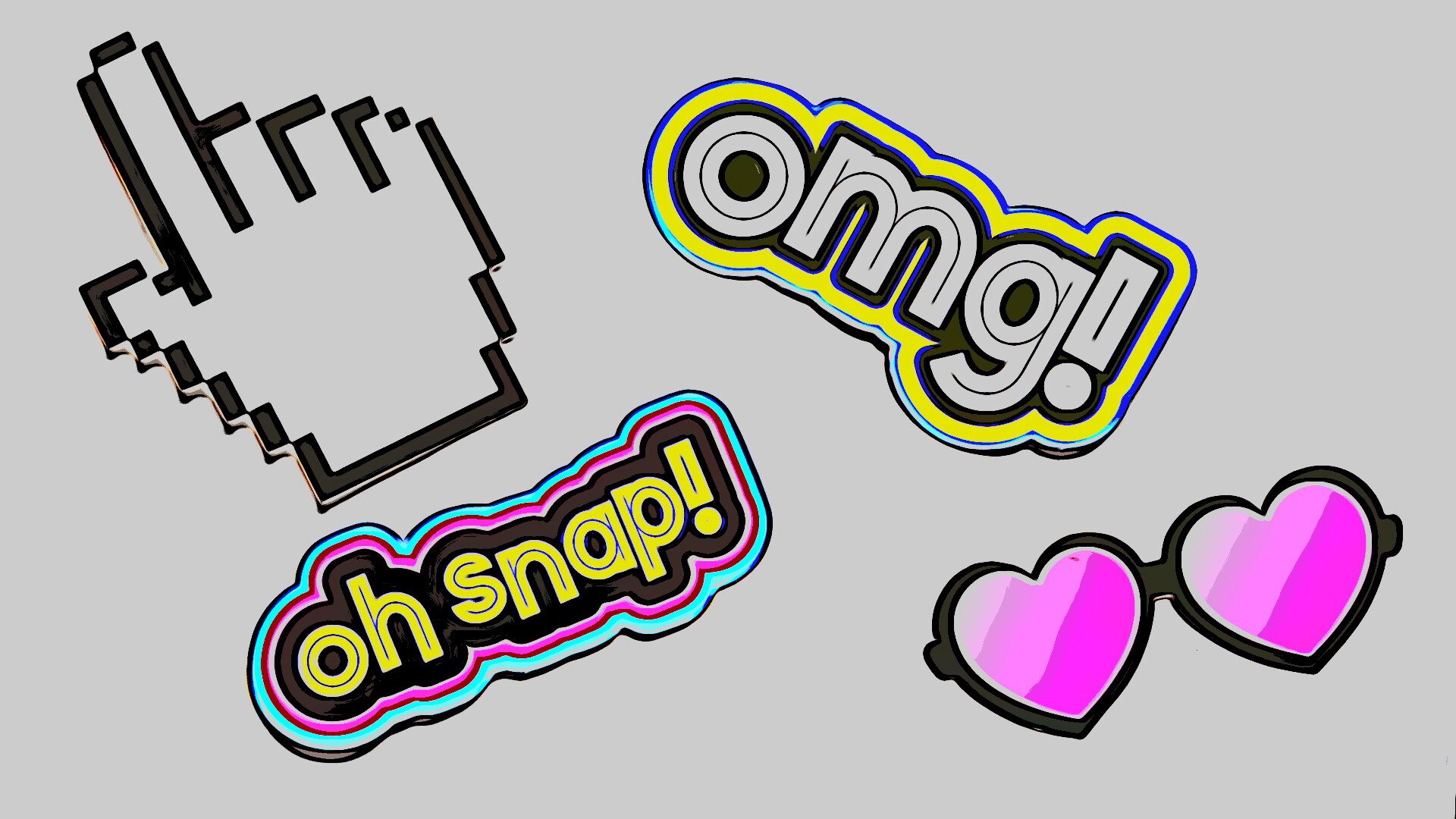Heute müssen wir über Gefühle reden. Über Frust, Wut und das Gefühl von Minderwertigkeit. Über Erleichterung, Freude und Begeisterung. Und darüber, was all diese Gefühle mit der Mission to Moni zu tun haben.
Ich sage ja über mich selbst, dass ich ein Kopfmensch bin. Rational, aber empathisch. Entscheidungen treffe ich fast immer mit dem Kopf und nur selten aus dem Bauch heraus.
Aber heute soll es um Gefühle gehen, diese schwer fassbaren, verwirrenden kleinen Biester, die immer dann auftauchen, wenn der Kopf sie gerade am allerwenigsten braucht und die alles durcheinander bringen.
Ich habe in der Vorbereitung zur Mission to Moni einige Gefühle durchlaufen. Oft waren sie ein wichtiger Antrieb für mich, weiterzumachen. Denn auch wenn ich mich mittlerweile sehr auf die sechs Monate freue – ich war nicht immer davon überzeugt, dass das eine clevere Idee ist.
Unzufriedenheit
Ein diffuses Gefühl der Unzufriedenheit begleitete mich seit mehr als einem Jahr. Mein Job bietet mir jede Menge Freiheit, ich werde gut bezahlt, schufte mich nicht zu Tode. Ich kann eigene Ideen einbringen, habe viel Gestaltungsfreiraum. Klingt super, oder? Und trotzdem…irgendwas fehlte.
Frust
Anerkennung fehlte. Zumindest aus meinem direkten Umfeld. Teil eines großen Ganzen zu sein fehlte. Ich kam mir oft vor wie ein Einzelkämpfer. Noch dazu einer, der gegen Windmühlen kämpft. Eine Zukunftsperspektive fehlte. Wohin kann ich mich in den nächsten knapp 35 Jahren bis zur Rente noch entwickeln? (Immerhin werde ich wahrscheinlich noch länger arbeiten als ich bereits lebe. Schluck.)
Ich will gar nicht jemandem den Schwarzen Peter zuschieben, vielleicht lesen meine Chefin und meine Kollegen ja sogar mit. Ich habe mit Sicherheit auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich in meinem Umfeld nicht wohlgefühlt habe. Aber da war dieses Gefühl, dass ich da nicht hingehöre, weil ich anders bin und denke. Vielleicht ein bisschen krawalliger. Vielleicht ein bisschen unbequemer. Vielleicht ein bisschen fordernder. Und das hat mich auf Dauer frustriert. Weil ich nicht den Eindruck hatte, dass ich mein Bestes gebe. Und weil ich irgendwann nicht mehr den Eindruck hatte, die Beste für meinen Job zu sein.
Minderwertigkeit
Dieser Eindruck hatte noch einen negativen Nebeneffekt: Ich fing an, an mir und meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Versteht mich nicht falsch: sich hin und wieder zu hinterfragen, ist definitiv sinnvoll. Das Gefühl, eigentlich gar nichts richtig zu können, ist aber weder produktiv noch gerechtfertigt. Ich bin gut in meinem Job, aber ich hatte angefangen, an mir selbst zu zweifeln. Und es war nicht leicht, da wieder rauszukommen.
Wut
Irgendwann schlugen der Frust und das Minderwertigkeitsgefühl in Wut um. Nur ganz kurz. Ich war wütend auf alles und jeden. Auf das System. Auf meine Chefin. Auf mein Unternehmen. Auf die Schafe, die jeden Morgen ins Büro gingen und gefühlt ihr Hirn und ihre Persönlichkeit an der Garderobe abgaben. (Ihr seht, ich wurde ganz schön überheblich, als ich wütend war.) Und auf mich selbst. Weil ich es so weit hatte kommen lassen.
Verzweiflung
Aus der Wut wurde Verzweiflung. Ich fühlte mich gefangen und wusste nicht, was ich tun sollte. Eines Abends war ich nach einem frustrierenden Termin beides – sehr wütend und sehr verzweifelt. An diesem Abend hatte ich nur einen Gedanken: „Macht euren Scheiß doch alleine, ich kündige.“
Aber ich bin ein Kopfmensch. Also schlief ich eine Nacht darüber. Frust, Wut und Verzweiflung waren auch am nächsten Morgen noch da. Da war aber auch die Einsicht, dass momentan vielleicht nicht die beste Zeit ist, um mal eben zu kündigen. Also überlegte ich, welche Möglichkeiten sich mir noch bieten. So weitermachen wie bisher war nicht drin, so viel wusste ich. Dann kam mir der rettende Gedanke: Ich mache ein Sabbatical.
Erleichterung
Es klingt vielleicht plakativ, wenn ich jetzt sage: Augenblicklich spürte ich eine wahnsinnige Erleichterung. Aber es ist wahr. In dem Moment, in dem ich für mich beschloss, mir eine Auszeit zu nehmen, fiel mir ein ganzer Steinbruch vom Herzen. War ich die Tage davor schlecht gelaunt und angespannt gewesen, so hüpfte ich jetzt durch die Wohnung. Ich hatte einen Ausweg aus meiner Situation gefunden. Jetzt musste ich ihn nur noch gehen.
Angst
Und dann kam die Angst. Die Angst davor, dass ich vielleicht nicht in der Lage sein könnte, diese Idee umzusetzen. Weil meine Chefin mich nicht gehen lässt. Weil ich nicht genug auf der hohen Kante habe, um mal eben über mehrere Monate hinweg auf mein Gehalt zu verzichten. Angst davor, wie mein Umfeld reagieren würde. Aber auch die Angst davor, zu versagen. Mich komplett zu verzetteln. Am Ende dieser Zeit immer noch dazustehen und nicht zu wissen, wie es weitergehen soll. Hätte ich nicht wunderbare Menschen um mich herum gehabt, die für mich da waren, mit mir Ideen gesponnen haben und mich ermutigt haben, wäre die Mission to Moni vielleicht an dieser Stelle schon beendet gewesen, bevor sie angefangen hatte.
Freude
Als die organisatorischen Rahmenbedingungen geklärt waren und ich mich realistisch mit der finanziellen Seite der Mission to Moni auseinandergesetzt hatte, kam dank dieser Menschen auch die nächste Emotion: Freude. Ich freute mich auf alle Möglichkeiten, die vor mir liegen. Ich freute mich darauf, selbst in die Hand zu nehmen, welche Richtung mein Leben einschlägt. Und natürlich freute ich mich auch darauf, sechs Monate lang das zu tun, was ich tun möchte, wann ich es tun möchte. Ich habe Lust, lange zu schlafen? Dann ist das so. Ich habe Lust, ein bestimmtes Buch zu lesen? Go for it! Ich will ein paar Tage raus in die Natur und nur mit mir alleine sein? Dann tue ich das.
Motivation
Diese Freude setzte eine Welle der Motivation in mir frei. Gut, das ist jetzt vielleicht kein Gefühl. Aber ich merkte, dass ich dadurch auch für die verbleibenden Wochen in meinem Job wahnsinnig viel Schwung mitnahm. Sogar so viel, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, ob ich das mit der Mission to Moni nicht vielleicht doch sein lasse. Aber nur ganz kurz.
Was bleibt nach diesem Wechselbad der Gefühle?
Viele dieser Gefühle melden sich in regelmäßigen Abständen wieder. Ich habe immer noch Angst – aktuell davor, dass Corona mir einen größeren Strich durch die Rechnung machen könnte (Stichwort Risikogebiet). Aber auch dafür werde ich eine Lösung finden. Ich bin wahnsinnig dankbar für die wunderbaren Menschen um mich herum. Ich bin voller Vorfreude auf die Zeit, die vor mir liegt. Und ich bin mir sicher, dass ich in 6 1/2 Monaten zurückblicken und denken werde: „Geil.“
Nicht alle werden diese Einschätzung teilen – aber das macht nichts. Wie mein Umfeld auf die Ankündigung der Mission to Moni reagiert hat, darum wird es in meinem Blogpost am kommenden Montag gehen.